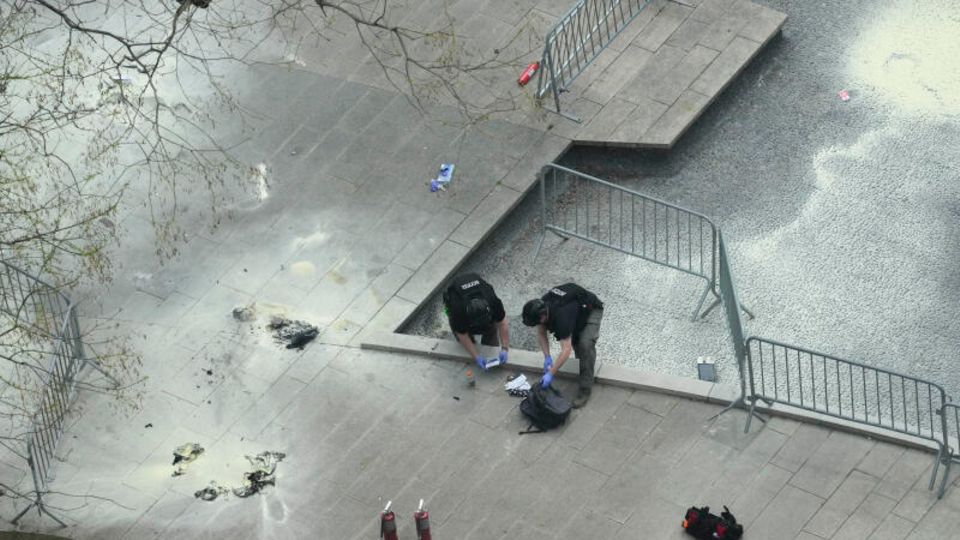Noah hat einen bösartigen Gehirntumor. Seit Monaten kämpfen die Ärzte um das Leben des Zweijährigen. Dabei sind solche schwer kranken Patienten für eine Klinik finanziell gesehen oft ein Desaster. "Eigentlich müsste ich sagen: Sorry, du bist zu teuer", sagt Rupert Handgretinger, Leiter der Uni-Kinderklinik Tübingen.
Denn extrem schwere Fälle würden im deutschen System der Fallpauschalen nicht ausreichend berücksichtigt, beklagt auch der Verband der Universitätskliniken. Fast alle Krankenhäuser der Maximalversorgung schreiben rote Zahlen. Das bleibt auch für die Patienten nicht ohne Konsequenzen.
Bei jedem Patienten muss Handgretinger den Katalog der Fallpauschalen vor Augen haben. Für Hunderte Krankheitsbilder ist darin geregelt, wie lange ein Patient im Krankenhaus bleiben sollte und wie viel Geld die Klinik für ihn bekommt.
Doch wenn die Behandlung deutlich länger dauert und dadurch immer teurer wird, dann bekomme die Klinik finanzielle Probleme, sagt der Mediziner. Zwar gebe es Zuschläge für "atypische Extremkostenfälle" - aber die seien zu niedrig. Viele Kliniken der Maximalversorgung klagen über dieses Problem.
Wie viel Krankenhäuser im Gegenzug daran verdienen, dass Patienten früher nach Hause können, die Fallpauschalen also nicht ausgeschöpft werden, ist nicht bekannt.
Wenn aus zehn Tagen 250 Tage werden
Handgretinger erinnert sich an eine elfjährige Patientin mit der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Eine Verweildauer von zehn Tagen sehe der Katalog dafür vor. "Aber dem Mädchen ging es so schlecht, dass es 250 Tage lang isoliert in seinem Krankenhauszimmer auf eine Lungentransplantation warten musste." Dafür habe die Klinik eine Fallpauschale von 124.000 Euro bekommen.
Gekostet habe die Behandlung 180.000 Euro. Und weil das Kind isoliert in einem Zimmer liegen musste, konnte das zweite Bett die ganzen Monate über nicht belegt werden. Das habe noch einmal mit 50.000 Euro zu Buche geschlagen. Für die Klinik ein herber finanzieller Schlag. Aber der Aufwand habe sich gelohnt: Dem Mädchen gehe es wieder gut, erzählt der Arzt.
Gut 250 solcher Patienten hat die Tübinger Kinderklinik pro Jahr. In einem so großen Krankenhaus sind das nicht viele. Trotzdem seien diese wenigen Fälle dafür verantwortlich, dass die Klinik im vergangenen Jahr bei 40 Millionen Euro Umsatz drei Millionen Euro Verlust gemacht habe, sagt Geschäftsführer Wolfgang Stäbler. Jetzt verlangt der Aufsichtsrat ein Sparprogramm. "Das heißt: Wie müssen noch mehr Patienten mit noch weniger Personal behandeln."
Wenige Fälle bringen das Budget durcheinander
In vielen Krankenhäusern ist das nicht anders. Im Klinikum Stuttgart waren 2011 zwar nur 0,4 Prozent der Patienten Extremkostenfälle - doch durch sie wurde mit 6,7 Millionen Euro ein Großteil des Defizits erwirtschaftet. Seit Jahren wird Personal abgebaut. "Die Patienten bekommen das längst zu spüren", sagt Personalratschef Jürgen Lux. Einige Pfleger gäben offen zu, dass sie es nicht mehr schafften, das Essen rechtzeitig zu den Patienten zu bringen - oder auch Schmerzmittel und Antibiotika nach Zeitplan zu verabreichen. "Das ist eine unerträgliche Situation."
Insgesamt veranschlagt der Verband der Universitätskliniken den jährlichen Verlust, der den deutschen Unikliniken allein durch solche Extremkostenfälle entsteht, auf rund 175 Millionen Euro.
Die Politik müsse handeln, fordert Handgretinger. Sonst werde ein Arzt irgendwann überlegen müssen, ob er einen Patienten mit einem komplizierten Fall überhaupt noch aufnehmen könne - oder ob er damit die Existenz des ganzen Krankenhauses aufs Spiel setzen würde.