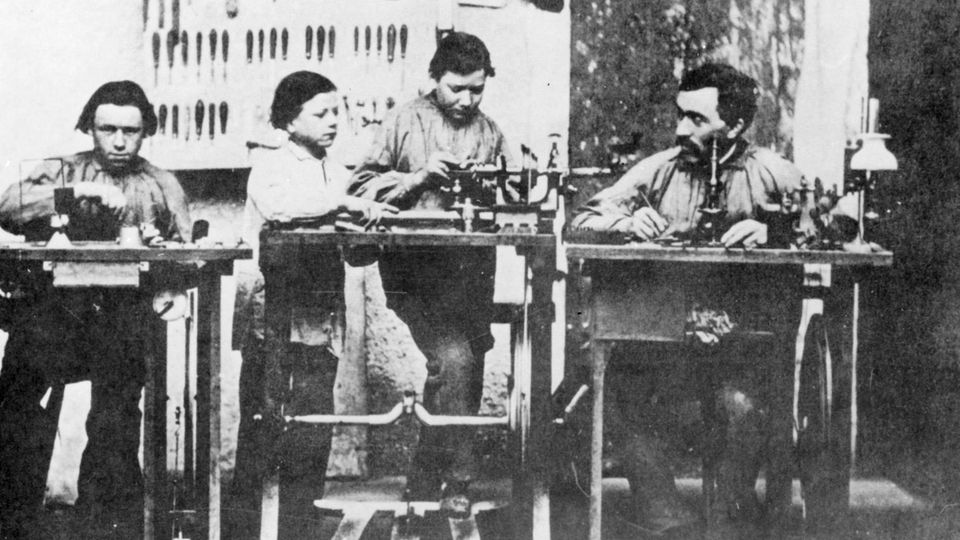Die Zettel fehlen ihm. Neben all dem anderen. Die Schnipsel mit den kleinen Aufträgen, die Olga ihm immer auf den Küchentisch gelegt hatte, für den Fall, dass er vor ihr nach Hause kommen sollte. Mit ihrer etwas gezackten, steilen Schrift: "Bitte Staub saugen". "Bitte Wäsche aufhängen." "Bitte Blumen auf dem Balkon gießen". Alexander hat diese Aufgaben immer erledigt. "Natürlich", sagt er. "Das war doch normal."
Normal war auch, dass "Ola", so wurde sie von ihrer Familie genannt, ihren Mann bereits morgens im Bett fragte, was er abends gern essen wollte. Normal war, dass sie gleichzeitig telefonieren, kochen, den Kindern die Schuhe zubinden, fernsehen, sich schminken und den anderen zuhören konnte. Normal war, dass sie zu lauter Musik im Radio sang, Liebesfilme auf Video aufnahm und "eine Schnulze nach der anderen" bis spät in die Nacht anschaute. Normal war, dass sie bereits am Montag Pläne für das Wochenende machte.
Aus Kasachstan ins Münsterland
Normal war auch, dass meist jemand aus der Familie bei ihnen zu Besuch war. Viktor*, der Onkel, Mirka, die Cousine, Tanja, die Tante. All die Verwandten, die nur ein paar Häuser weiter in derselben Straße wohnten, 14 insgesamt. Von 1995 an waren sie nach und nach übergesiedelt, aus Wannowka in Kasachstan nach Telgte im Münsterland. Dazwischen 5000 Kilometer Luftlinie, fünf Zeitzonen, vier Grenzen. Eine Familie von Russlanddeutschen - von "Spätaussiedlern", wie es auf den Formularen der Behörden hieß -, die vier Jahre nach dem Ende der Sowjetunion beschlossen hatte, all ihre Hoffnungen darauf zu setzen, dass die Beschreibungen von dem wunderbaren Leben in Deutschland zutreffen würden. Beschreibungen, von denen sie in den Briefen anderer, früherer Aussiedler gelesen hatten.
Im beschaulichen Telgte, 19.600 Einwohner, zwölf Kilometer von Münster entfernt, hatten sie ein neues Leben, ihr neues Zuhause gefunden.
Am Ostersonntag 2008, genau um 19.57 Uhr, beendete ein Holzklotz das Leben von Olga K. Auf der Autobahn A 29 zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg bei Kilometer 42,0 wurde sie von einem sechs Kilo schweren Pappelstamm erschlagen. 24 Zentimeter hoch, 18 Zentimeter dick. Der Klotz traf ihren Hals, die linke Schulter, den Brustkorb. Olga K., 33 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, war sofort tot. Unbekannte hatten den abgesägten Baumstamm von einer Brücke auf den silberfarbenen BMW geworfen. Die Familie war nach einem Besuch in Wilhelmshaven auf dem Heimweg. Alexander saß am Steuer, der Wagen fuhr mit etwa 120 km/h, als die sechs Kilo Pappelholz durch die Windschutzscheibe schmetterten.
Sechs Kilo Holz. 120 km/h. Eine Wucht von zwei Tonnen.
Ein paar Minuten zuvor hatte Olga noch ihre Tante aus dem Auto angerufen, um ihr frohe Ostern zu wünschen. "Wir sind bald zu Hause", sagte sie. Und: "Die Kinder sind müde. Wir sehen uns morgen und freuen uns. Bis dahin." Jannik, 9, und Lara, 7, saßen angeschnallt auf der Rückbank. Olga erzählte, wer von der Familie zum Geburtstagsfrühstück der Cousine am Tag darauf kommen werde. Es war dunkel, aber Alexander kannte die Strecke ja von den vielen Besuchen bei ihren Freunden in Wilhelmshaven, Russlanddeutsche wie sie. Die Frau war schon in Kasachstan Olgas beste Freundin gewesen, jetzt verbrachten sie häufig das Wochenende bei ihnen. Zwei Minuten nach dem Telefongespräch, plötzlich "ein Knall, den ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf bekomme", sagt Alexander. Ein schwarzer Schatten, Splitter, die Windschutzscheibe platzte auf der Beifahrerseite, etwas schlug mit ungeheurer Kraft ein. Alexander bremste den Wagen ab, fragte nach hinten: "Kinder, alles okay?" "Alles okay", antworteten sie. Dann begannen beide zu weinen.
Mund-zu-Mund-Beatmung hilft nicht mehr
"Ola, alles okay?" Keine Antwort. Es war dunkel. Er konnte nichts sehen im Wagen. Fuhr auf den Standstreifen. Hielt an. Machte die Tür auf. Da ging die Innenbeleuchtung an. Und er konnte erkennen, was passiert war. Auf Olgas Schoß ein Holzklotz, in der Windschutzscheibe ein gezacktes, aufgerissenes Loch, überall Splitter. Blut. Olga antwortete nicht. Ihr Kopf hing links nach unten. Die Kinder haben geschrien.
Alexander machte noch im Auto eine Mund-zu-Mund-Beatmung, versuchte sie ins Leben zurückzuholen. Dann eine Herzmassage. "Doch da war alles so weich, ganz eingedrückt."
Ihm wurde klar: "Klotz. Loch. Brücke. Vorbei." Er rief mit seinem Telefon die Polizei. Jannik, der hinter seinem Vater gesessen hatte, sah die Wunde am Hals der Mutter. Er schnallte sich ab und weinte ihr ins Ohr: "Mama." "Mama." "Mama." Und Lara fragte: "Ist die Mama jetzt tot?" Immer wieder. "Bitte seid leise", flehte Alexander. "Ich muss der Mama doch helfen. Ich muss doch hören, ob ihr Herz noch klopft."
Jede Hilfe kam zu spät
Acht Minuten später kamen Polizei und Sanitäter. Zwei Männer vom Roten Kreuz legten Olga auf eine Trage und brachten sie zum Rettungswagen. Sie bekam Elektroschocks. Alexander durfte nicht zu ihr. Jannik konnte durch das Fenster des Wagens einen Monitor erkennen, und darauf eine Linie. Später wird er seinem Vater davon erzählen: "Die war ganz gerade."
Plötzlich brach die Hektik in dem Krankenwagen ab, und Alexander konnte durch die Scheibe erkennen, dass die Ärzte und Sanitäter stillstanden. Und da wusste er, dass sie nicht mehr zurückkommen würde. Olga.
Sie wurden zur Polizeistation gebracht, die Kinder vom Roten Kreuz versorgt. Alexander bot man Kaffee an. Als er in ein Zimmer mit vier Polizisten kam, dachte er, "jetzt sagen sie dir einen dieser schlimmsten Sätze in deinem Leben. Wie im Film". Und so war es: "Ihre Frau ist tot."
Soko "Brücke" ermittelt
Der Anschlag auf der Autobahn erschütterte die Menschen im ganzen Land. Polizeibeamte der Soko "Brücke" suchten in den an die Autobahn angrenzenden Wohngebieten von Oldenburg nach Zeugen, befragten Besucher der beiden Osterfeuer, die zwei und sechs Kilometer vom Tatort entfernt gefeiert hatten. Die Sendung "Aktenzeichen XY" veröffentlichte fünf Tage nach der Tat ein Phantomfoto mit einer Gruppe Jugendlicher - und wurde mit 5,91 Millionen Zuschauern zur meistgesehenen Sendung des Tages. Die Belohnung für Hinweise wurde von 3000 auf 6000 Euro verdoppelt.
Psychologen äußerten sich zum möglichen Motiv der Täter - die Tat verschaffe denen, die sie ausführen, anonymen Ruhm, das Gefühl von Macht. Zudem sei sie einfach zu begehen, das Risiko der Entdeckung gering. Politiker forderten die stärkere Überwachung von Brücken - in Deutschland gibt es davon über 37 000 auf Fernstraßen und Autobahnen.
Was bleibt, ist die Angst vor jener Gefahr, die sich nicht kalkulieren, nicht verringern oder vermeiden lässt. Es kann jeden treffen - und es gibt keinen Schutz. Absurde Realität: Seit Ostern stieg die Zahl der Nachahmer, die sich auch von drohenden Ermittlungen wegen Mordes nicht abschrecken ließen. Sie warfen Steine, Lehmklumpen, Getränkekartons oder gefüllte Flaschen auf fahrende Wagen auf der Autobahn.
Drei Tage nach ihrem Tod wurde Olga in einem Abschiedshaus in der Nähe von Telgte aufgebahrt: Die Familie hatte 24 Stunden Zeit, sich von ihr zu verabschieden, sie im offenen Sarg noch einmal zu sehen. Im Oktober zuvor war Olga einmal dort gewesen, ihr Neffe war gestorben. "Wenn einer von uns mal sterben muss, dann treffen wir uns hier", hatte sie gesagt. "So schön ist es."
Beerdigung in der Lieblingskleidung
Olgas Schwester Helena hatte gemeinsam mit Alexander aus ihrem Schrank den goldfarbenen Blazer mit dem schwarzen Rock ausgesucht, den Olga so gern bei Feiern und Hochzeiten getragen hatte.
Ein weißer Rollkragenpullover bedeckte den zerschmetterten Brustkorb. Kerzen brannten, das Wasser plätscherte in einem Tischbrunnen, leise Musik aus dem Film "Titanic", rote Rosen.
Die Kinder legten auf die Decke Briefe, die sie ihr geschrieben hatten. Verziert mit bunten Blumenranken und Schutzengeln. Als Jannik sich verabschiedete, legte er seine Hand lange auf die der Mutter. Weinte.
"Nie werden wir Dich vergessen"
Drei Wochen danach. Sonntag. Alexander geht zum Friedhof. Wie jeden Tag mindestens einmal. Kränze aus roten und weißen Nelken, Blumensträuße, Gipsengel. Weiße Schleifen mit goldener Schrift: "Viel zu früh bist Du von uns gegangen". Und: "Nie werden wir Dich vergessen". Grablichter flackern. Alexander faltet die Hände und blickt auf das schlichte Holzkreuz mit dem Namen seiner Frau.
Er spricht leise. Mit russischem Akzent. "Ola hat mir so viel beigebracht. Sie war viel offener und selbstständiger als ich. Ich brauchte immer ihren Rat, und sie hatte auf alles eine Antwort. Sie hat mir gezeigt, dass man durchhalten, ein Ziel vor Augen haben muss. Ich muss das schaffen. Ich will das für Ola schaffen." Und: "Ich muss doch zeigen, dass ich lebendig bin."
Als die 20-jährige Olga im Mai 1995 mit ihren Eltern und der fünf Jahre jüngeren Schwester Helena von Kasachstan nach Deutschland kam, war sie neugierig auf dieses Land, in dem die Straßen mit Shampoo gewaschen werden, in dem alle ein Haus mit Garten haben und in dem die Geschäfte "Kaufparadies" heißen. So hatte man es sich in Wannowka erzählt, der kleinen Stadt in ihrer Heimat, 2500 Kilometer von Moskau entfernt.
Helena brauchte lange, bis sie sich in Deutschland eingelebt hatte. "Aber Olga kam hierher", erinnert sie sich, "besuchte einen Sprachkurs, fand einen Job als Verkäuferin und sofort Freunde. Sie nahm mich überall mit hin und lachte: 'Die werden uns schon verstehen.' Sie war in Deutschland einfach angekommen."
"Das ist er"
Knapp ein halbes Jahr später lernte sie Alexander kennen, auch er ein Spätaussiedler aus Kasachstan, Lkw-Fahrer, bereits seit fünf Jahren mit seinen Eltern und den zwei Schwestern im Land. Nur fünf Tage später stellte sie ihn auf einem Geburtstag ihrer Familie vor. "Das ist er", sagte sie und ließ an ihrer Entscheidung keinen Zweifel.
Alexander erinnert sich noch an den Tag, als er Olga über einen Freund kennenlernte. "Es war der 22. Oktober 1995. Da stand sie, diese gut aussehende junge Dame. So schön geschminkt, mit roten Haaren, und ein so offenes Gesicht", sagt er. "Was ich nicht konnte, das konnte Ola. Ihr Mut, ihre Lebensfreude, ihre Zuversicht haben mir immer Kraft gegeben. Sie war mein Motor. Mein Antrieb."
"Olga liebte seine Beständigkeit. Seine Ruhe", erzählt Helena, die Schwester. "Und auch wenn sie manchmal fragte, warum man den Männern ständig auf die Füße treten müsse, fühlte sie sich bei Alexander geborgen. Sie konnte sich auf ihn immer verlassen. Sie wusste ihn auf ihrer Seite."
Kinder, Haus, Garten
Beide wohnten noch bei den Eltern. Sie gingen jeden Tag spazieren, saßen stundenlang in seinem Auto, hörten Radio, und Olga machte Pläne: Kinder, ein kleines Haus, ein Kartoffelacker im Garten. Und einmal im Leben Kanada sehen. "Diese Weite spüren."
Alexander, drei Jahre älter, versprach ihr all das - aber: "Erst eine Wohnung, dann Hochzeit, danach Kinder. So gehört es doch. Eins nach dem anderen, Ola." 1996 zogen sie zusammen. 1997 heirateten sie, im Januar 1999 bekamen sie einen Sohn, im Oktober 2000 eine Tochter. "Und als Mutter wurde sie schöner und schöner", sagt Alexander.
Olgas Eltern wohnten nur zwei Balkone entfernt, Alexanders Familie lebte im nächsten Dorf. Am Wochenende übernachteten die Kinder bei den Großeltern, Alexander und Olga gingen tanzen. Oder schwimmen. Ins Kino. Oder sie trafen sich mit Freunden zum Essen.
Familie kommt zur Karaoke
Nur manchmal, wenn ihm ihre Unruhe zu viel wurde, bat Alexander sie: "Ola, heute bleiben wir zu Hause." Dann lachte sie und lud die Familie zum Karaoke ein - sie hatte eine Sammlung mit 3000 russischen Liedern. Oder sie schnitt allen die Haare. Kochte Plow, ein kasachisches Reisgericht mit Fleisch und Gemüse, das sich doch nur lohnt, "wenn man es für die ganze Familie macht".
Olga, sagt Helena, "war immer für jeden da. Nur um sich selbst kümmerte sie sich nicht." Und so ignorierte sie lange die Schmerzen in ihrer rechten Brust. "Ola, geh bitte zum Arzt", bat Alexander sie. "Nächste Woche, dann habe ich Zeit", antwortete sie. Immer wieder. Im Juni 2003 sagte Olgas Mutter: "Wenn du jetzt nicht zum Arzt gehst, schleppe ich dich persönlich dorthin. Mit der ganzen Familie."
Brustkrebs rechts. Fortgeschritten. Einzige Therapie: Amputation. "Sofort", riet der Arzt. Olga saß nur still da und nickte.
"Mir wurde ganz schlecht", sagt Alexander. Sein Großvater war an Krebs gestorben, Alexander hatte miterlebt, wie sehr er sich gequält hat. "Ich hatte solche Angst um Ola", sagt er.
Am nächsten Tag wurden ihr die rechte Brust und 18 Lymphknoten entfernt. "Meine starke Ola", erinnert sich ihr Mann. "Wir müssen leben, hat sie zu mir gesagt. Es ist zu früh für uns, wir müssen doch für die Kinder da sein."
Als sie nach Hause kam, das erste Mal duschte, kam Alexander mit dem Handtuch ins Bad, um ihr zu helfen. Nackt stand sie vor ihm. Weinte. Er verstand. Nahm sie in die Arme, sagte: "Ola, ich habe dich immer so geliebt, wie du bist. Auch jetzt."
Eine langwierige Krankheit
Dann die Chemotherapien. Sechs im Abstand von jeweils drei Wochen. Alexander, der nun in der Fertigung einer Elektrofirma arbeitete, nahm unbezahlten Urlaub. Wusch sie, fütterte sie, hielt ihr die Schüssel, wenn sie vor Übelkeit nicht mehr aufstehen konnte, brachte die Kinder an ihr Bett - jeweils immer nur für wenige Minuten, denn sie war noch so schwach -, wusch, bügelte und las Jannik und Lara abends Gutenachtgeschichten vor. Dann musste Olga sechs Wochen zur Kur, die Familie fehlte ihr. "Zu viele Krebsleute."
Später ging sie regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen, und immer wieder gab es Knoten, die entfernt werden mussten - sieben weitere Operationen folgten. "Und kein einziges Mal hat sie gesagt, dass sie es nicht schafft", sagt Alexander. "Sie ließ alle wissen, dass sie durchhalten werde, für die Kinder, für ihre Familie."
Sie ließ sich eine Silikonprothese einsetzen - und wieder entfernen, weil sie sie nicht vertrug. Sie arbeitete wieder als Verkäuferin im Supermarkt, "weil sie den Krebs aus dem Kopf vertreiben wollte". Ging mit Freundinnen einmal in der Woche zu einem Bauchtanzkurs. "Tanz doch einmal auch für mich, Ola", bat Alexander sie. Doch Olga lachte verschämt.
"Jetzt habe ich es geschafft"
Im Dezember 2007 dann die letzte Kontrolluntersuchung. Sie wollte das Ergebnis noch vor Weihnachten wissen. 22. Dezember. Als sie mittags nach Hause kam, blinkte der Anrufbeantworter. Keine weiteren Metastasen. Olga weinte wie ein Kind. "Jetzt habe ich es geschafft", sagte sie abends zu Alexander, als sie darauf anstießen. "Das Kämpfen hat sich gelohnt."
Silvester verbrachten sie in Bayern, in den Bergen. Und nachts träumte sie von Wannowka, sie erzählte es jeden Tag ihrer Schwester. Im kommenden Sommer wollten sie dort hinfahren. Den Kindern zeigen, wo die Mutter groß geworden ist. Die Schulfreundin besuchen, mit der Olga regelmäßig telefonierte. "Und vielleicht doch noch kirchlich heiraten, Alexander. Ganz in Weiß. Jetzt, wo ich doch gesund bin."
Die Vierzimmerwohnung in Telgte, in die sie erst im vergangenen Sommer eingezogen sind. Überall Orchideen, Olgas Lieblingsblumen: auf den Fensterbänken, dem Esstisch, die Kinder mit Bleistift porträtiert an den Wänden.
"Jetzt ist nichts mehr normal", sagt Alexander. Seit Ostersonntag, dem 23. März 2008, ist die Zeit mit Olga zum "Früher" geworden, zum "Vor diesem Tag".
Alles soll so bleiben
Im Schlafzimmer fehlt rechts das Bettzeug. Stattdessen eine gefaltete Tagesdecke über dem Bett. Sie hatten ihre Übernachtungssachen an jenem Wochenende mit nach Wilhelmshaven genommen, "Olas Decke ist noch im Auto, das die Polizei beschlagnahmt hat", erklärt Alexander. "Aber das Bettzeug kommt hierher zurück. Zurück auf Olas Platz, wo es hingehört." Alles soll so bleiben, wie Olga es gemacht hat. "Ich will nichts falsch machen."
Morgens, wenn Alexander noch nicht ganz wach ist, greift er neben sich. "Und dann höre ich wieder diesen Knall. Und alles ist da." Oder wenn er den Kleiderschrank aufmacht, und alles riecht nach ihr. "Dann tut es so weh, dann kann ich sie fast spüren. Jetzt werde ich sie nie mehr im Arm haben."
Alexander erzählt seine Geschichte, weil "ich hoffe, dass ihre Mörder das hier lesen". Und erkennen, wen sie da getötet haben - nicht nur eine 33-jährige Frau aus Telgte, sondern Olga, die Mutter von Jannik und Lara. Eine mutige, lebenslustige, starke Frau, die so an ihrem Leben gehangen hat. "Es ist doch unmenschlich, so etwas zu tun," sagt der Witwer.
Bis heute, gut vier Wochen danach, weiß die Polizei nicht, wer hinter dem Anschlag steckt. "Wir haben keine heiße Spur", gibt Staatsanwalt Stefan Schmidt unumwunden zu. Noch immer werten die 27 Beamten der Sonderkommission "Brücke" die über 600 Hinweise aus der Bevölkerung aus. Der Pappelklotz wird auf Fingerabdrücke, Faserspuren und DNA untersucht. Ob es sich bei der mit einem Phantomfoto gesuchten Gruppe von Jugendlichen, die ein Zeuge gegen 20 Uhr auf der Brücke gesehen haben will, um die Täter handelt - oder vielleicht doch um Zeugen -, ist ebenfalls ungeklärt. Ein weiterer Zeuge hatte inzwischen behauptet, der Holzklotz habe schon Stunden vor dem Anschlag auf der Brücke gelegen.
Das Leben von "früher"
Ein Kalender an der Pinnwand in der Küche zeigt noch das Leben von "früher", "vor diesem Tag". In Olgas zackiger, steiler Schrift sind die Geburtstage eingetragen: die Termine für den Arzt, das Karatetraining, die Malschule, den Schwimmkurs und den Bauchtanz.
Die Familie wird therapeutisch betreut. Doch Alexander will es allein schaffen. Als ihn die Psychologin fragt, weshalb, antwortet er: "Ola hat auch immer alles allein geschafft." Helena erkennt ihren Schwager oft nicht wieder. "Er war immer der Stillere. Aber jetzt ist er in seiner Traurigkeit erstarrt." Er hat Urlaub genommen, für seine Kinder. Die Großeltern, die während Olgas Krankheit die Enkel betreuten, wollen sich auch in Zukunft um sie kümmern, sie von der Schule abholen, sie zum Schwimmkurs bringen, zum Karatetraining.
"Jannik und Lara verhalten sich normal, sagen die Traumatologen", erzählt Alexander. Das Mädchen spricht über seine Mutter, lacht, malt, trifft sich mit Freunden. Und beschwert sich: "Mama hat uns aber immer vor der Schule eine Zuckerstange gekauft." Auch bei den Hausaufgaben sei sie besser gewesen, und bei ihr habe sie auch mal vor dem Fernseher essen dürfen.
Ein verschlossener Junge
Das Mädchen liebte es, sich gemeinsam mit seiner Mutter zu schminken, sich zu kämmen, immer wieder in den Spiegel zu schauen. "Der Junge ist eher so wie ich", sagt Alexander. "Verschlossener, stiller und ein bisschen ruhiger. Er spricht über seine Mutter, aber nicht über das, was er beim Unfall gesehen hat."
Als Lara ihren Bruder vor ein paar Tagen im Auto fragte, ob er auch wolle, dass man die Täter finde, schrie Jannik sie fast an: "Lass mich in Ruhe, ich will darüber nicht reden."
Später am selben Tag gingen er und Alexander gemeinsam zum Friedhof. Und vor den Gipsengeln, den Nelken, den weißen Schleifen mit der goldenen Schrift und dem schlichten Holzkreuz mit Olgas Namen nahm der Junge die Hand seines Vaters, drückte sie und sagte: "Sie fehlt mir. Sie fehlt mir einfach." Und Alexander nickte.
*Die Namen der Angehörigen wurden geändert
Mitarbeit: Gerd Elendt, Kerstin Schneider